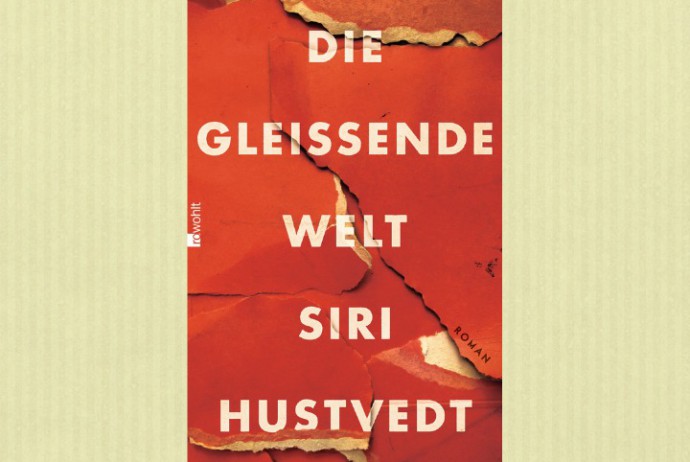Krach, zisch, funkel: Siri Hustvedts neuer Roman muss sich ständig größer machen als er ist. Dabei hat er das gar nicht nötig
Sie hieß Jasmin, und sie war anders als die anderen. Während sich meine Erstsemester-Freundinnen 1989/90 mehrheitlich eher für Film-Soundtracks, neonfarbene Oberteile und die Telefonnummer des großen Blonden aus dem Einführungsseminar für Neue Deutsche Literatur interessierten, war Jasmin eine Intellektuelle reinsten Wassers. Wenn ein Kerl sie wirklich zum Schwärmen brachte, dann war es Ludwig „Worüber-man-nicht-reden-kann-darüber-soll-man-schweigen“-Wittgenstein. Ja, genau, der Poster-Philosoph mit dem durchdringenden Blick. So sehr mich ihre intellektuelle Begeisterung zuerst ansteckte (und mir meine Bildungslücken schmerzlich bewusst werden ließ), so sehr wurde sie mir im Lauf der Zeit Leid. Nicht, weil ich es nicht ertragen konnte, dass da jemand möglicherweise schlauer war als ich – sondern weil mir dieses Namedropping auf die Nerven ging, dem nichts folgte. Zwar konnte Jasmin stundenlang in fast teenagerhafter Weise vom Gesamtwerk eben jenes Sprachphilosophen schwärmen – aber wenn man sie nach dem Grund ihrer Faszination fragte, dann kam nur ein dürres: „Das kann ich nicht erklären, dass muss du sehen/hören/im Original lesen.“ Irgendwann trennten sich unsere Wege.
Warum ich das erzähle? Weil ich in den letzten zwei Wochen Jasmins Wiedergängerin begegnet bin, jedenfalls zwischen zwei Buchdeckeln. Die heißt Siri Hustvedt, versteckt sich bei ihrem Namedropping-Spielchen geschickt hinter erfundenen Charakteren, aber hat mich zeitweise nicht minder angestrengt als ihre Schwester im Geiste. Dass ich ihr trotzdem nicht die Freundschaft gekündigt habe, hat ebenfalls seinen Grund. Aber der Reihe nach.
Siri Hustvedt ist die Frau von Bestseller-Autor Paul Auster, und wahrscheinlich liegt in diesem sachlichen Satz nicht nur ihr persönliches Lebensglück, sondern gleichzeitig auch ihr geballter Lebensfrust. Möglicherweise auch ein Anlass, ihr jüngstes Buch zu schreiben, mit dem sie gerade durch Deutschland tourt. „Die gleißende Welt“ handelt im Kern von einer alternden Künstlerin, Harriet Burden, die – passend zu ihrem sprechenden Nachnamen – schwer an der Last trägt, nur als „Frau von“ wahrgenommen zu werden. Felix heißt er, der Glückliche, ein erfolgreicher Kunsthändler und Sammler. Dass die Frau an seiner Seite nicht nur eine hervorragende Gastgeberin von New Yorker Intellektuellenpartys ist und die Mutter der mittlerweile erwachsenen Kinder, sondern ebenfalls künstlerische Ambitionen und Begabungen hegt, dass will der bornierten Society nicht in den Kopf. Nach seinem Tod entschließt sich Harriet Burden zu einem großen Akt von Konzeptkunst: Sie will drei ihrer Werke männlichen Künstlern unterjubeln, um zu beweisen, dass ihre Stimme erst dann Gehör findet, wenn sie in einer männlichen Verkleidung daherkommt. Um dann der Welt eine Nase zu drehen: Ätsch, kaum gibt sich ein Kerl als Schöpfer meiner Sachen aus, findet ihr das tiefsinnig und schaut genauer hin. Die Rechnung geht auf, dennoch nimmt das Spiel einen unerwartet tragischem Ausgang: Dem ersten ihrer Strohmänner, einem jungen Kunst-Gigolo, steigt der unverdiente Erfolg so zu Kopf, dass er in eine Identitätskrise schlittert. Der zweite immerhin, ein sympathischer schwarzer Schwuler und damit nicht minder Außenseiter als Möchtegern-Künstlerin Harriet, geht unbeschadet aus dem Experiment hervor – dafür wird der dritte Deal zur absoluten Katastrophe für beide Seiten.
Das liest sich erst einmal wie eine spannende Versuchsanordnung rund um weibliche und männliche Identität, wie eine intelligente Gesellschaftskritik und ein Psychogramm, das mich interessieren könnte. Hallo, eine intellektuelle Hauptfigur, schwierig und zerrissen wie aus einem frühen Woody-Allen-Film, das ist doch mal ein schöner Kontrast zu den hemdsärmligen, das Herz auf dem rechten Fleck tragenden Heldinnen, die einem sonst aus der englischsprachigen Literatur und den dazu passenden Filmen entgegenspringen! Nur leider wird die Sicht auf eine toll konstruierte Geschichte hier von einer Menge Nebelkerzen verschleiert. Denn Siri Hustvedt erzählt nicht einfach nur, nein: ihr Plot muss als Materialsammlung daherkommen. Als Zusammenstellung fiktiver Protokolle von Harriet Burdens Weggefährten, Interviews mit fiktiven Kunstkritikern und Essays, die in ihrem akademischen Duktus ungefähr so sinnlich daherkommen wie eine Sammlung von Mikrofilmen in einer Uni-Bibliothek der Neunziger. Puh. Immer schön mit Fußnoten garniert, in denen von Husserl bis Heidegger sämtliche Geistesgrößen der letzten Jahrhunderte aufgefahren werden. So als würde der ganze Roman ständig aufgeregt blinken und tröten und Spruchbänder schwenken: Ich bin so schlau! Ich bin so gebildet! Ich möchte bewundert werden!
Man könnte auch sagen: Der Roman macht die Jasmin. Eine Zwiebel, die man mühsam schälen muss und dabei eher gequält als gerührt in Tränen ausbricht. Wenigstens auf den ersten 100 Seiten. Bis ich dann beinahe soweit war, ihn entnervt wegzulegen und mir zu denken: Dann geh doch selbst mit Husserl und Heidegger ins Bett, ich will dich nicht mehr auf meinem Kopfkissen haben. Weil ich nicht auf jeder Seite vorgeführt bekommen möchte, wie wenig ich weiß – sondern weil ich lieber verführt werden möchte, mit Hilfe einer Geschichte auch in komplizierte Gedankenwelten hineinzukommen. Ich bin nämlich gar nicht hirnfaul. Ich möchte nur eingeladen werden und nicht abgewiesen.
Irgendwann musste ich dann auch daran denken, welchen Effekt die Texte von Siri Hustvedts Mann auf mich hatten, als ich sie vor über 20 Jahren zum ersten Mal las. Nein, längst nicht alle Roman von Paul Auster sind brillant, aber in seinen besten Momenten – etwa im Klassiker „Mond über Manhattan“ – hat er mich zutiefst gepackt und begeistert, weil ich dachte: So geht das also! Eine packende Geschichte beinahe im Krimi-Stil erzählen und subkutan, ganz unauffällig Gedanken darin unterbringen über Identität, das Rätsel der eigenen Biographie, die Fallstricke der Liebe! Und eigentlich, fand ich nach Siri Hustvedts großartiger Familiengeschichte „Was ich liebte“, kann sie das auch – anders als ihr Mann, weiblicher, körperlicher, mir und meiner Gefühls- und Gedankenwelt sogar noch näher. Wem musste sie denn jetzt beweisen, dass sie noch eine Schaufel drauflegen kann, gebildeter, begabter, funkelnder ist als ihr Mann? Mir jedenfalls nicht. Oder soll ich mich jetzt fragen, ob Paul überhaupt schreiben kann – oder ob er in Wahrheit nur ein hübscher Posterboy mit Wittgenstein-Blick ist und Siri eigentlich die Ghostwriterin seiner gesammelten Werke?
Was aus Jasmin geworden ist, weiß ich nicht, aber die “Gleißende Welt” und ich sind nach unserer großen Krise dann doch noch Freunde geworden. Darüber bin ich froh. Ich hätte sonst eine Menge verpasst. Passagen wie diese Harriet-Burden-Tagebuchsätze: „Ich will im gleißenden Licht erstrahlen, es krachen lassen und brüllen. Ich will mich verstecken und weinen und mich an meiner Mutter festhalten. Das wollen wir doch alle.“ Berührende Szenen von Tod, Verlust und Liebe, und Kunstbeschreibungen, die mir Lust machen, sofort ein Billigticket nach Venedig zu buchen und über die derzeitige Biennale zu schlendern. Wer sich ohne abgeschlossenes Mehrfachstudium ans Lesen wagt, dem sei geraten: Räumt einfach den funkelnden Schotter der ersten fünfzig bis hundert Seiten aus dem Weg und macht euch auf den Weg ins Zentrum. Das lohnt sich nämlich sehr. Schade, dass es so gut versteckt ist.