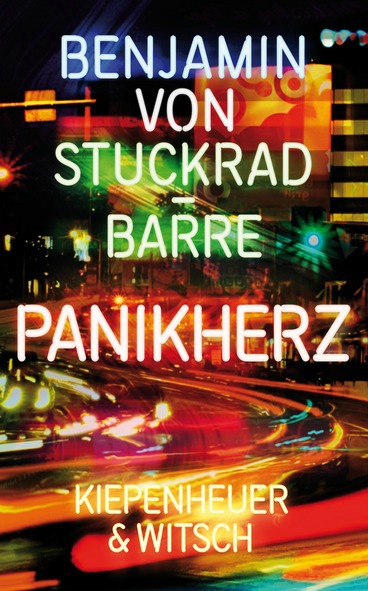Schon der Anfangssatz ist eine Falltür in die Vergangenheit. Meine eigene Vergangenheit. „Am Morgen waren die Kohlen gekommen“, so beginnt die erste Geschichte in „Lettipark“, dem neuen Kurzgeschichtenband von Judith Hermann. Mehr braucht es nicht, und schon ist alles wieder da in meinem Kopf: wie das war in Berlin, damals, nach dem Fall der Mauer, aber noch vor dem Hauptstadtumzug. Wo man immer jemand kannte, der in einer sagenhaft billigen Riesenwohnung in diesen neu zu entdeckenden Stadtteilen im Osten wohnte, mit einer Kohleheizung, die den Himmel über Berlin vernebelte. Es war die Zeit der Elektromusik in umgenutzten Straßenbahndepots, von Clubs in Abrisshäusern, der poetischen Vorläufigkeit, die uns so betörte. Uns, die wir in den 90er Jahren junge Erwachsene mit westdeutschen Geburtsorten waren. Wenn ich an Berlin denke und überhaupt das Lebensgefühl dieser Zeit, dann denke ich an mich mit Ende 20 (wie auf dem Foto oben), aber auch an die Lesebühnen und Poetry Slams, die damals an jeder Straßenecke aufpoppten. An junge Frauen mit Zöpfen im ganz speziellen Second-Hand-Berlin-Schick. Und an Judith Hermann natürlich, eine der Patinnen des „literarisches Fräuleinwunders“. So jedenfalls die leicht altväterliche Bezeichnung des „Spiegel“. Zufall oder nicht, schon ihr Debüt „Sommerhaus, später“ von 1998 begann mit einer Geschichte über Kohlen, die Erinnerung an einen Großvater, der in Briefen so wortreich über Öfen schreibt wie er über die Liebe schweigt. Danach ist es allerdings vorbei mit der Parallele: Die Kohlen aus dem Eröffnungssatz von „Lettipark“ werden nicht etwa nach Berlin geliefert, nicht in den Prenzlauer Berg, sondern in ein heruntergekommenes Landhaus. Vielleicht tatsächlich jenes Sommerhaus, das die älter gewordenen Figuren von 1998 jetzt besitzen. Ohne dort das Glück zu finden, natürlich. Denn „Glück“, so hieß es in einem der früheren Judith-Hermann-Bände, „Glück ist immer der Moment davor“.
Frühjahrsbestseller 2016: Literarische Shooting-Stars werden erwachsen
Es ist ein sonderbarer Zufall, dass ausgerechnet die wohl bekanntesten Literaturlieblinge der 90er Jahre, mittlerweile beide 40-somethings, in diesem Frühjahr mit neuen Büchern am Start sind. Auf der einen Seite Judith Hermann, diese Chronistin der Sehnsucht, dieses Postergirl der neuen Innerlichkeit. Auf der anderen Benjamin v. Stuckrad-Barre, Gottvater der Popliteratur, King des Zynismus, Role Model einer ganzen Generation von Männern, die in den 90ern enge Trainingsjacken zur After Hour-Party trugen und für einen scharfen Spruch ohne Bedenken ihre Mutter verkauft hätten. Beide Autoren sind mit ihren neuen Büchern zurückgekehrt zu ihren Wurzeln: Hermann zu diesen schwebenden, sehnsuchtsdurchtränkten Kurzgeschichten, die sie damals berühmt machten – aber mit Figuren, die gemeinsam mit ihr und uns gealtert sind. Die sich in der Lebensmitte fragen, ob das noch geht, lichterloh zu brennen, für einen Menschen oder eine Idee, und die ängstlich nach den älteren, illusionslosen Frauen schielen, die ihnen vorangehen. Stuckrad-Barre dagegen liefert ein neues, pointiertes Selbstporträt. Schon früher schimmerte autobiographisches durch seine Texte („Soloalbum“, „Livealbum“), entzog sich aber früher dem direkten Zugriff. Alles echt, alles nur geklaut, alles erfunden? Und der Autor dahinter: Kotzbrocken oder empfindsamer Jüngling? Man wusste es nie. Anders als die poetische Hermann erzählte er sehr offensiv und direkt von alledem, was für ihn (und auch mich) die Neunziger ausmachte: Musik (der ewige Streit zwischen Blur und Oasis), neue Medien, neue Party, und immer wieder neue Lieben. Nun, älter geworden, zeichnet er das Bild seines eigenen Lebens deutlich weniger schmeichelhaft nach. „Panikherz“ ist ein Porträt des Künstlers als kaputter Mann, inklusive jahrelanger Drogensucht, Essstörungen, Abstürze. Den scharfen Zynismus, den er einst als Gagschreiber für die Harald Schmidt-Show trainierte, hat er dabei nicht etwa abgelegt – der wendet sich aber nicht mehr gegen mittelmäßige Musiker, sondern gegen Suchttherapeuten, Kollegen, und nicht zuletzt in voller Wucht gegen sich selbst. Der einzige, den er außen vorlässt, ist ausgerechnet Udo Lindenberg. Die Männerfreundschaft zu dem Hamburger Nuschelrocker hat ihm, so lässt er durchblicken, das Leben gerettet.
Lesen im Reißverschlussystem, Samples wie auf der Technoparty
Es ist eine ganz andere Art von Sprache, und es sind völlig unterschiedliche Geschichten, die diese völlig unterschiedlichen Autoren erzählen, über sich selbst, über das Leben zwischen 20- und 40-something, über die Welt. Doch ob raunend verklausuliert oder schmerzhaft schmutzig und direkt: Beide Bücher enthalten gleichzeitig auch unsere eigene Geschichte, die Geschichte unserer Generation, die Geschichte von Größenwahn und Niedergang, von Sehnsüchten, die in Mittelmäßigkeit ersticken, Westentaschendramen, Fremdheit, jeder Menge ungestilltem Hunger. Das ist groß, so oder so. Es ergab sich, dass ich beide Bücher in einer Art Reißverschlusssystem parallel gelesen habe: eine Geschichte Hermann, zehn Seiten Stuckrad-Barre und so weiter. Ein Verfahren, das mich an Musik-Samples aus den 90ern erinnert hat: Volkslieder, Schlager, Donauwalzer kombiniert mit Techno-Beats und Elektro. Das Ergebnis: so vertraut wie überraschend, wie ein Wiedersehen beim 20jährigen Abitreff und gleichzeitig ein Resonanzraum, der die gesamte verlorene Zeit wieder zum Leben erweckt. Ein literarischer Egotrip im Doppelpack. Für ein paar Tage war ich wieder 27, wie damals, als ich nachts im Münchner Atomic Café zu obskurem Sechziger-Jahre-Pop feierte, in diesem ganz neuen Ding namens Internet surfte, und auf den eigenen Gefühlswellen. Als ich ausgelesen hatte, fühlte ich mich sehr jung. Und sehr alt. Sehr inspiriert. Und sehr desillusioniert. Denn die Abgründe, in die uns Stuckrad-Barre und Hermann schauen lassen, sind immer auch unsere eigenen.
Zu den Büchern:
Judith Hermann, Lettipark
Benjamin v. Stuckrad-Barre, Panikherz